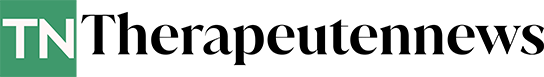Untersuchungen in den USA und in Deutschland
Zur Untersuchung des Vorkommens des Burnout-Syndroms wurde dessen Ausprägung bei Psychotherapeuten in den USA erhoben (Farber & Heifetz, 1982). Die Hälfte der männlichen und 79,2% der weiblichen Therapeuten werden in dieser Studie unter dem Stichwort Burnout aufgeführt, wobei die privat arbeitenden oder erfahreneren weniger betroffen sind als die in Institutionen arbeitenden oder jüngeren Kollegen. Die Psychotherapeuten, die unter dem Burnout-Syndrom leiden, beschreiben die Einseitigkeit der Bemühungen, die oftmals ohne sichtbaren Erfolg vonstatten gehen, als besonders belastend (57,4%), es folgen Überarbeitung (22,2%), Schwierigkeiten im Umgang mit Problemen der Klienten (20,4%) und Entmutigung aufgrund langsam voranschreitender Veränderung (13%). 25% der Therapeuten fühlen sich gelegentlich desillusioniert, weitere 55% schützen sich gegen solche Gefühle, indem sie die Ziele und Begrenzungen von Psychotherapie neu einzuschätzen lernen. Nur 20% berichten von keinen desillusionierenden Gefühlen, die meisten deshalb, weil sie davon überzeugt sind, dass ihre Therapie wirksam ist. In der Studie wird aber auch von positiven Seiten der Profession berichtet. Die mit der Arbeit des Therapeuten einhergehende Befriedigung führen 75% der Therapeuten darauf zurück, Klienten in ihrem Veränderungsprozess zu helfen, 50% auf ihr angewachsenes Verständnis der menschlichen Natur und 40% auf das Gefühl von Nähe mit den Klienten. Die Forscher sehen als einen Puffer der eher stressreichen Aspekte therapeutischer Arbeit diese postitiven Erlebnisse, insbesondere die Möglichkeit der Therapeuten, durch ihre Arbeit selbst zu wachsen, beständig etwas Neues zu lernen, und sich als Person weiterzuentwickeln.
Eine weitere amerikanische Studie berichtet, sie sei nur kurz erwähnt, dass 82% der untersuchten Therapeuten an Beziehungsproblemen und 57% an Depressionen leiden (Radeke & Mahoney, 2000).
Dass 71% einer weiteren amerikanischen Stichprobe von Psychotherapeuten schon mindestens einmal selbst in Therapie waren, kann, muss aber kein Anzeiger für ihre Befindlichkeit sein, sondern kann auch schlicht auf die größere Nähe der Therapeuten zu diesem Thema hinweisen (Norcross, Strausser-Kirtland & Missar, 1988).
Bevor die durchaus positiveren deutschen Studien aufgeführt werden, soll hier eine ebenfalls aus den USA stammende Zusammenfassung belastender Aspekte des Therapeutenberufs gegeben werden. Die allgemeinen Quellen der Belastung von Psychotherapeuten können nach Mahoney in drei Bereiche zusammengefasst werden. Sie betreffen:
1.) Arbeitsbedingungen: Darunter Isolation, ein übermäßiges Arbeitspensum, ein überhöhtes Maß schwieriger Patienten, Zeitdruck, organisatorische Maßnahmen, berufliche Konflikte, ein Übermaß an Papierarbeit, ökonomische Unsicherheit und Untätigkeit.
2.) Private Angelegenheiten: Körperliche Erschöpfung, emotionale Auszehrung, die gefühlte Verantwortung für das Wohlbefinden des Klienten, ein geringer Selbstwert, Mitnahme der Arbeit ins Privatleben, Beziehungsschwierigkeiten, Zweifel an der Effektivität der Therapie, emotionale Selbstkontrolle, der unvermeidliche Verlust von Klienten bei Beendigung der Therapie, andere Belastungen (wie Umzug oder Familienereignisse).
3.) Klientenverhalten: Suizidäußerungen oder –versuche, aggressives oder abweisendes Verhalten, starke Angst, vorzeitiger Abbruch der Therapie, Depression und Hoffnungslosigkeit, impulsive Handlungen, intensive Abhängigkeitsverhältnisse, Anrufe beim Therapeuten, Paranoia, gestörtes Verhalten, verführerisches Verhalten, schizoide Abspaltungen, überraschende soziales Aufeinandertreffen, schwankende Bezahlungsweise, verpasste Sitzungen, Verspätungen, Widerwille die Sitzung zu beenden, Widerstand.
In der deutschsprachigen Forschungsliteratur gibt es nur eine spärliche Anzahl an Studien zum Thema, die aber ein positiveres Bild der Befindlichkeit deutscher Therapeuten belegen. Eine Klinik, die ein ambulantes Spezialprogramm gegen Burnout unter Psychotherapeuten und Ärzten anbietet, berichtet allerdings von einem im Vergleich mit der ansonsten ambulant behandelten Bevölkerung erhöhten Werte der Psychotherapeuten und Ärzte zu Beginn der Maßnahme; sie scheinen länger als andere mit dem Beginn einer Behandlung zu warten (vgl. Speck et al., 2005).
Nach einer interessanten Studie aus dem Jahre 1997 sind jedoch fast ¾ der Psychotherapeuten in ihrem Beruf zufrieden und erleben kaum Unzufriedenheit. Nur 6,5% sind unzufrieden und können wenige Momente der Zufriedenheit mit ihrem Beruf ausmachen; auffällig ist die hohe Anzahl berufserfahrener Therapeuten in der Gruppe der Zufriedenen. Der Unterschied ist so augenfällig, dass die Autoren fragen: „Bedeutet dies, dass die Therapeuten ihre Karriere im Mittel eher unzufrieden beginnen (und manche dann schon aufhören) […] [und es den anderen] schließlich gelingt, die therapeutische Tätigkeit so zu gestalten, dass die Personen mit ihrer Tätigkeit zufrieden sind?“ (Willutzki, Ambühl, Cierpka, Meyerberg & Orlinsky, 1997, S.212). Deutschsprachige Psychotherapeuten liegen, was ihre emotionale Erschöpfung und ihre „Dehumanisierung“ angeht, unter den von Maslach und Jackson (1986) ermittelten Werten, die ein Mittel verschiedener sozialer Berufe abbilden, und empfinden sich zudem als leistungsfähiger. Dies deutet auf eine erhöhte Zufriedenheit und somit auf eine gute Effektivität der Therapeuten hin. Die Autoren wenden jedoch ein, dass Therapeuten, die sich, gestresst und verstimmt, innerlich von ihrer Arbeit zurückgezogen haben, eventuell keinen Aufwand für eine Studie dieser Art betreiben und somit in der Auswertung fehlen würden (Willutzki et al., 1997).
Eine weitere Studie stellt ebenfalls eine überwiegende Zufriedenheit mit dem Beruf fest (Reimer, 2005). Die psychologischen Psychotherapeuten sind, bezogen auf ihre Arbeit, hochsignifikant zufriedener als die ärztlichen Psychotherapeuten. 81,4% der psychologischen und 62,3% der ärztlichen Psychotherapeuten sind „im Großen und Ganzen“ zufrieden mit der Arbeitssituation, ca. 10,5% beider Gruppen gar „sehr“ zufrieden. 53% geben in beiden Gruppen an, mit ihrem Leben generell „ziemlich“ zufrieden zu sein. 41% der psychologischen und 33,3% der ärztlichen Psychotherapeuten sind „sehr“ zufrieden, in der Kategorie „außerordentlich“ zufrieden finden sich 2% der psychologischen und 6,1% der ärztlichen Psychotherapeuten. In der Beurteilung des Wohlbefindens bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (Ärzten und Psychologen), 10,1% der ärztlichen und 2,9% der psychologischen Psychotherapeuten bezeichnen ihren Gesundheitszustand als „sehr gut“, im Mittelfeld liegen die Mediziner zurück (36,2% vs. 51% in der Kategorie „gut“), doch treffen sich die beiden Gruppen wieder in der Kategorie „zufriedenstellend“ (36,2% vs. 39,2%). Als „eher schlecht“ oder „sehr schlecht“ bewerten 17,3% der Mediziner und 6,9% der Psychologen ihr Wohlbefinden. Interessanterweise schätzen 51% der ärztlichen Psychotherapeuten, aber auch noch 29,9% der psychologischen Psychotherapeuten ihren Lebensstil als ihre Gesundheit „beeinträchtigend“ ein, als förderlich hingegen bezeichnen 47,8% der psychologischen und 31,4% der ärztlichen Psychotherapeuten ihren Lebensstil.
Zu einer Erhöhung der Lebensqualität von Psychotherapeuten, so die Studie, könnten individuell anwendbare Psychohygienemaßnahmen und eine bessere finanzielle Absicherung beitragen. Auch Überlegungen zu den Belastungen und Ressourcen von Traumatherapeuten, die Gefahr der sekundären Traumatisierung beispielsweise (Figley, 2002), enthalten wichtige Daten und Anregungen. Ihre Vertreter können als Vorreiter der Belastungs- und Ressourcenforschung von Therapeuten angesehen werden. Unter ihnen ist im deutschsprachigen Raum besonders Luise Reddemann zu erwähnen, die sich in ihrer Ausbildung von Traumatherapeuten intensiv mit den Belastungen des Berufs beschäftigt. Sie bietet Seminare an, die explizit die Belastungen von Therapeuten in den Mittelpunkt stellen und Ressourcen im Umgang mit traumatisierten Klienten, wie auch im Privatleben, fördern wollen. Sie weißt auf die „ungesunde Genügsamkeit“ der Therapeuten hin (Reddemann, 2003, S.79) und warnt: „Einige psychotherapeutische Theorien scheinen der Selbstfürsorge geradezu entgegen zu stehen. Da ist z.B. der völlig überdehnte und missverstandene Begriff des „containing“ und die Vorstellung, dass es zu einer guten Therapie gehöre, alle Scheußlichkeiten, die Patienten an uns herantragen, in uns zu behalten“ (Reddemann, 2003, S.81). Daher kann, so die Literatur, eine Tabuisierung seelischer und körperlicher Grenzen als weitere Belastung des Berufs gelten, durch die sich Psychotherapeuten dem Anspruch der immer Gesunden unterwerfen (Speck et al., 2005, vgl. Cierpka, Orlinsky, Kächele & Buchheim, 1997).
Fazit
Die Herausforderungen an Psychotherapeuten in ihrem Beruf sind vielfältig, jedoch stellt sich die Situation der überlasteten Therapeuten in Deutschland besser dar als in den USA. Auch im Vergleich zu den deutschen Ärzten scheint es den Therapeuten besser zu gehen.
Dass es ein besonderer Anspruch an den Therapeuten ist, für sein Wohlbefinden und seine Gesundheit zu sorgen, leitet sich sowohl aus der Therapieforschung wie aus einzelnen Therapierichtungen ab. Dieser Artikel sollte aber nicht als tabuzementierender Anspruch an die Therapeuten dienen, immer gesund und wohlauf zu sein, sondern im Gegenteil dazu einladen, sich verantwortungsbewusst um eine wohlbalancierte Gesundheit zu bemühen, der eigenen Person und dem Klienten zuliebe.
Außerdem sollte durch einen Überblick über die vorhandenen Studien zum Thema ein nüchterner Blick auf die täglichen Herausforderuzngen des Berufs gewährt werden. Die Komplexität des menschlichen Daseins erstreckt sich auch auf Gesundheit und Wohlbefinden. Gerade ein Therapeut wird das wissen. Mit welchen Ressourcen und Mitteln die Therapeuten ihrem Alltag begegnen, um Burnout und ungesunden Stress zu vermeiden, das möchte ich in einem weiteren Artikel in dieser Folge beschreiben.
Literatur
- Antonovsky, A. (1997). Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: DGVT. (Originalarbeit erschienen 1980)
- Bader, K. (1985). Viel Frust und wenig Hilfe. Band 1: Die Entmystifizierung sozialer Arbeit. Weinheim: Beltz
- Burisch, M. (1989). Das Burnout-Syndrom. Theorie der inneren Erschöpfung. Berlin: Springer
- Cierpka, M., Orlinsky, D., Kächele, H. & Buchheim, P. (1997). Studien über Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Psychotherapeut, 1997- 4, 269-281
- Dryden, W. (1985). Therapists’ Dilemmas. London: Sage
- Dryden, W. & Spurling, L. (1989) (Eds.). On Becoming a Psychotherapist. London: Routledge
- Enzmann, D. & Kleiber, D. (1989). Helfer-Leiden. Stress und Burnout in psychosozialen Berufen. Heidelberg: Asanger
- Farber, B. A. & Heifetz, L. J. (1982). The Process and Dimensions of Burnout in Psychotherapists. Professional Psychology, 13, 293-301
- Figley, C. R. (2002). Compassion Fatigue: Psychotherapists’ Chronic Lack of Self Care. Journal of Clinical Psychology, 2002 – 58 (11), 1433-1441
- Gildemeister, R. (1983). Als Helfer überleben. Neuwied: Luchterhand
- Gussone, B. & Schiepek, G. (2000). Die “Sorge um sich”. Burnout-Prävention und Lebenskunst in helfenden Berufen. Tübingen: DGVT
- Jaeggi, E. (2001). Und wer therapiert die Therapeuten? Stuttgart: Klett-Cotta
- Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Interaktionen zwischen Person und Umwelt. In J. R. Nitsch (Hrsg.), Stress. Theorien, Untersuchungen, Maßnahmen (S.213-259). Bern: Hans Huber
- Mahoney, M. J. (1991). Human Change Processes. New York: Basic Books
- Müller, B. (1985). Die Last der großen Hoffnung. Methodisches Handeln und Selbstkontrolle in sozialen Berufen. Weinheim: Juventa
- Norcross, J. C., Strausser-Kirtland, D. & Missar, C. D. (1988). The Processes and Outcomes of Psychotherapists’ Personal Treatment Experiences. Psychotherapy, 25, 36-43
- Peick, P. A. & Klawe, W. (1981). Selbsthilfe für Helfer. Kontrolle des beruflichen Handlens: Grundlagen, Beispiele, Übungen. München: Kösel
- Radeke, J. T. & Mahoney, M. J. (2000). Comparing the Personal Lifes of Psychotherapists and Research Psychologists. Professional Psychology, Research an Practice, 31, 82-84
- Reddemann, L. (2003). Burnoutprophylaxe von TraumatherapeutInnen. Erfahrungen und Hypothesen. ZPPM, 2003, 79-85
- Reimer, Ch. (2005). Lebensqualität von ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten. Eine Vergleichsuntersuchung. Psychotherapeut, 2005, 107-114
- Schmidbauer, W. (1977). Die hilflosen Helfer. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Schmidbauer, W. (1983). Helfen als Beruf. Die Ware Nächstenliebe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Speck, M. & Horsch, E. (2005). Berufsrisiko Psychotherapie: Ist Leid ansteckend? Psychologie heute, 2005, 64-69
- Willutzki, U., Ambühl, H., Cierpka, M., Meyerberg, J. & Orlinsky, D. (1997). Zufrieden oder ausgebrannt: Die berufliche Moral von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. In P. Janssen, M. Cierpka & P. Buchheim (Hrsg.), Psychotherapie als Beruf (S.207-222). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht
Freie Übersetzungen der englischen Zitate:
- “The mental health of psychotherapists [is] instrumental in their work” (Deutsch, 1985, S.305). “Die psychische Verfassung der Psychotherapeuten ist an ihrer Arbeit maßgeblich beteiligt.“
- „The effects of serving as a mental health professional are particulary apparent, and although some of these effects are positive, others are decidedly negative” (Mahoney, 1991, S.356). “Die Auswirkungen auf diejenigen, die professionell im Bereich psychischer Versorgung arbeiten sind besonderes augenscheinlich, und obwohl einige dieser Auswirkungen positiv sind, sind andere in entschieden negativ.“
Autor: Keller Kathrin (Diplom-Psychologin & Heilpraktikerin für Psychotherapie)
NUTZUNG | HAFTUNG