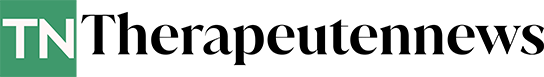Die Person des Psychotherapeuten als Wirkfaktor (also als im Therapieerfolg maßgeblicher Faktor) der Psychotherapie taucht seit einigen Jahren verstärkt in den Studien der Psychotherapieforschung auf. In diesem Artikel möchte ich allen, die sich für die Ergebnisse der wissenschaftlichen Psychologie interessieren, eine kurze Einführung in diese Forschung und die Möglichkeit geben, sich mit wenig Aufwand einen Überblick über die Ergebnisse anzueignen. Folgende Fragen, die Sie sich als Therapeut oder Klient in der Praxis möglicherweise schon selbst stellten, beschäftigten die Psychologen an den Universitäten und Forschungsinstituten und führten zu den weiter unten vorgestellen Ergebnissen: Gibt es bestimmte Faktoren wie Alter, Geschlecht oder beruflichem Hintergrund, die den Erfolg einer Therapie maßgeblich beeinflussen? Wie sieht es mit den Einstellungen und dem Wohlbefinden des Therapeuten aus, sind sie für eine effetive Therapie wichtig? Wie zentral ist die Fähigkeit des Psychologen, eine wohlwollende und stabile Beziehung zu seinem Klienten aufzubauen?
Einige dieser Faktoren sind gut erforscht, andere bislang noch nicht genug untersucht worden, um wissenschaftlich gültige Aussagen zu treffen. Dennoch ist die insgesamt ansteigende Anzahl der Studien, die sich mit der Person des Therapeuten befassen, eine positive Entwicklung, denn dieser wurde in der früheren Psychotherapieforschung (bis ca. in die 1980er Jahre) kaum Aufmerksamkeit geschenkt. In der Outcome-Forschung (Untersuchungen über die Erfolgsraten in der Psychotherapie) jener Zeit wurde sie gar als Fehlerquelle in der Auswertung von Studien zur Wirksamkeit verschiedener psychotherapeutischer Verfahren gewertet. Daher wurde sie nach Möglichkeiten „unterdrückt“, d.h. es wurde versucht, sie durch Standardisierung unsichtbar zu machen. Anstatt also den Psychotherapeuten seine Arbeit tun zu lassen, wie er es im Alltag täte, verwendete man für die Studien genauestens vorgegebene Standardmanuale, in deren Anwendung der Therapeut möglichst ohne charakteristische Merkmale agieren sollte (vorgegebene Texte, gleiche Stimmlage etc).
Das Forschungsprogramm der Outcome-Forschung wollte, dass therapeutische Verfahren getrennt von denen betrachtet werden, die sie „abliefern“. Trotz allen Bemühens konnte die Relevanz des Therapeuten für den Outcome auf Dauer jedoch nicht geleugnet werden (Beutler, Malik, Alimohamed, Harwood, Talebi, Noble & Wong, 2004): „Standardising the treatment has not eliminated the influence of the individual therapist on outcomes“ (Beutler et al., 2004, S.245, freie Übersetzungen der englischen Zitate am Ende des Artikels). Mittlerweile ist man einen Schritt weiter, und nun wird der Therapeut als Person und somit als wichtiger Wirkfaktor der Psychotherapie gesehen, ebenso wie die Interaktion zwischen Therapeut und Klient: und die Bandbreite der Therapeutenvariablen, die alle unterschiedlich viel Einfluss auf die Effektivität der Therapie haben, werden differenziert betrachtet (Abb. 1) und untersucht. Aus der Sicht der Psychotherapieforschung ist jedoch auch eine weitergehende Untersuchung der unterschiedlichen Therapeutenvariablen erstrebenswert (Beutler et al., 2004), der Stand der Forschung kann noch keinenfalls als abschließend betrachtet werden.
Der Psychotherapeut als allgemeiner Wirkfaktor
Hans Eysenck, ein Psychologe, der sich ganz den wissenschaftlichen Untersuchungen psychologischer Phänomene hingegeben hatte, forderte von den Therapeuten und Forschern seiner Zeit eine statistisch gültige Untersuchung über die Wirksamkeit von verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren. Die Wissenschaftler konnten tatsächlich die allgemeine Wirksamkeit von Psychotherapie durch ausgedehnte Forschung klären, allerdings mit dem denkwürdigen „Äquivalenzparadoxon“, das besagt, dass alle untersuchten Therapieformen gleich gut wirken. Dies hat in der Folge eine wahre Flut psychotherapeutischer Forschung ausgelöst, diesmal war sie aber nicht auf die einzelnen Verfahren beschränkt, sondern untersuchte allgemeine Wirkfaktoren. Denn das Äquivalenzparadoxon legte nahe, dass irgendetwas Therapie wirksam macht, was mit den einzelnen Ansätzen und Interventionen gar nicht so viel zu tun hat! Allgemeine Wirkfaktoren sind also Gegebenheiten oder Personen, die in allen therapeutischen Situationen vorhanden sind, z.B. der Therapeut, der Klient, die Interaktion zwischen beiden, das besondere Setting, in dem sie sich befinden etc. Es wurde tatsächlich bewiesen, dass diese mehr Ergebnisvarianz erklären, d.h. wichtiger für den Therapieerfolg sind, als die spezifisch angewandten Methoden (z.B. Verhaltenstherapie, Psychoanalyse etc.) (Strauß & Wittmann, 2005).
Die Idee war allerdings nicht ganz neu, sie wurde nun einfach zum ersten Mal durch quantitativen Methoden, d.h. durch kontrollierte Experimente in Forschungslaboren, in all ihren Aspekten beleuchtet. Die Geschichte allgemeiner Wirkfaktoren zieht sich jedoch schon durch das ganze 20. Jahrhundert, was für eine junge Wissenschaft wie die Psychologie eine lange Zeit ist, und wurde in den verschiedenen Jahrzehnten von Rosenzweig, Frank, Lambert und Grawe schematisiert und bekannt gemacht: Wo taucht bei den allgemeinen Wirkfaktoren, die sie fanden, die Person des Therapeuten als wichtiger Aspekt des therapeutischen Prozesses auf?
Rosenzweig (Hubble, Duncan & Miller, 2001; Strauß et al., 2005) hatte schon 1936 Überlegungen zu allgemeinen Wirkfaktoren vorweggenommen, die den Therapeuten jedoch übersehen, Frank (1981) suchte seit Anfang der 1960er nach dem gemeinsamen Nenner „traditioneller Psychotherapie, Gruppen- und Familientherapien, stationärer Behandlungen und religiös-magischer Heilprozeduren in nicht-industriellen Gesellschaften“. Vier Aspekte beeinflussen nach Frank den Klienten, der in einem Zustand der Demoralisierung den Therapeuten, Schamanen etc. aufsucht, in jeder effektiven Therapie, darunter die vertrauensvolle Beziehung zwischen Behandelndem und Hilfesuchendem, die durch die Akzeptanz und Zuversicht des Therapeuten geprägt ist und somit wesentlich von der Person des Therapeuten beeinflusst wird.
Auch in dem aktuell diskutierten Modell von Lambert (1992) wird der therapeutischen Beziehung 30% der Ergebnisvarianz zugesprochen. Hierunter fallen Merkmale des Therapeuten, die hilfreich für den Aufbau einer guten Arbeitsbeziehung sind, und solche, die ihn selbst betreffen, wie beispielsweise sein Wohlbefinden, und indirekt in den Therapieprozess einfließen. Grawe (1995) nennt als einen seiner vier empirisch fundierten allgemeinen Wirkfaktoren die Ressourcenaktivierung beim Klienten: hier betont er die tragfähige Beziehung zum Therapeuten als eine für den Klienten nutzbare Ressource. Außerdem hat der Therapeut insofern eine wichtige Aufgabe, als dass dieser dem Klienten maßgeschneiderte Angebote machen muss, so dass jener die jeweiligen Ressourcen auch wirklich aktivieren kann.
Der Therapeut in wichtigen psychotherapeutischen Verfahren
Natürlich haben auch die Psychotherapieschulen der Person des Therapeuten im Therapieprozess eine (unterschiedlich) große Rolle zugeordnet. Dies ist in hier aber nicht das Thema und soll hier nur am Rande Erwähnung finden: Die Verhaltenstherapeuten beispielsweise kennen das Lernen am Modell, welches durch den Therapeuten gefüllt werden kann. Die Psychoanalytiker betonen die Arbeit mit der Übertragungsbeziehung zwischen Klient und Therapeut, und verlangen von angehenden Psychoanalytikern ausgedehnte Selbstanalysen bei einem erfahrenen Kollegen. Und die Gesprächspsychotherapie hat den Therapeuten ins Zentrum ihres Interesses und ihrer Forschungen gestellt. Was kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass sie keine „Techniken“ wie andere Ansätze kennt. Rogers, der Begründer, kommt „to the somewhat uncomfortable conclusion that the more psychologically mature and integrated the therapist is as a person, the more helpful is the relationship he provides. This puts a heavy demand on the therapist as a person” (1975, S.5).
Es wurde auch festgestellt, dies wieder alle Ansätze betreffend, dass trotz durchschnittlichem Erfolg von Psychotherapie im allgemeinen eine große Varianz unter den Therapeuten existiert: „Some therapists appear to be unusually effective, while others may not even help the majority of patients who seek their services. It is apparent that a portion of those whom therapy is intended to help are actually harmed through inept application of treatment, negative attitudes, or poor combination of treatment technique and patient problem” (Lambert et al., 2004, S.181). Diese empirische Erkenntnis untermauert Rogers Aussage: Sowohl die adäquate Anwendung von Techniken als auch ein bewusster Umgang mit der eigenen Person liegen in der Verantwortung des Therapeuten, sich selbst, aber auch seinen Klienten gegenüber.
Empirische Befunde zu einzelnen Therapeutenvariablen
Welches sind nun die wichtigsten Therapeutenvariablen, auf die es wirklich ankommt? Wie sehen die Ergebnisse der Forschung aus? Die Vielfalt der entsprechenden Therapeutenvariablen wurde zur genaueren Analyse in folgendes schematisches Quadrantensystem unterteilt:
|
Objektive Merkmale |
|||
|
Situations-unabhängige Traits |
1 |
2 |
Therapie-spezifische States |
|
3 |
4 |
||
|
Subjektive Merkmale |
|||
Auf der Querachse werden hierbei situationsunabhängige und therapiesituationsspezifische Variablen (auch Traits und States) unterschieden. Das Schema trennt somit Variablen, die sich auf das Leben des Therapeuten außerhalb seiner Profession beziehen von solchen, welche die berufliche Rolle betreffen. Auf der vertikalen Achse werden objektive, also beobachtbare, von der Person des Therapeuten unabhängig feststellbare Merkmale von jenen Merkmalen unterschieden, die als subjektiv in dem Sinne bezeichnet werden können, als dass sie nicht direkt beobachtbar sind. Es handelt sich somit um hypothetische Konstrukte, die sich aus den Aussagen der Therapeuten erschließen lassen (Perrez & Baumann, 1998).
Die Ergebnisse einer umfassenden Meta-Analyse, das heißt einer Analyse aller vorliegenden Einzelstudien (Beutler et al., 2004), berichten für den ersten Quadranten (Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit) keine, für den am ausgiebigsten untersuchten zweiten Quadranten (beruflicher Hintergrund, therapeutischer Stil, therapeutische Intervention) hingegen einige interessante signifikante Zusammenhänge:
Das Konstrukt „freundliches Verhalten“ ergab einen konsistenten Zusammenhang mit guten Therapieergebnissen, ebenso wie ein Match ähnlicher Kommunikationsmuster zwischen Therapeut und Klient bessere Outcome-Ergebnisse erzielte. Auch für die verbale Aktivität des Therapeuten und sein Einbringen von Themen in die Therapie liegen positive Zusammenhänge mit den Therapieerfolgen vor.
Über die Nutzung von standardisierten Therapiemanualen liegen sehr unterschiedliche Ergebnisse vor, ist ihre Anwendung und Nutzung doch sehr von der Person des Therapeuten abhängig: Es gibt insgesamt wenige Anhaltspunkte dafür, dass Therapiemanuale Therapieerfolge verbessern, die effektivsten Therapeuten sind diejenigen, die von vorgegebenen Manualen abweichen.
Der dritte Quadrant enthält die inferred traits des Therapeuten (Persönlichkeits- und Copingmuster, Emotionales Wohlbefinden, Werte, Einstellungen). Diesen Variablen kam in der Forschung der letzten Jahrzehnte nicht sehr viel Aufmerksamkeit zu, obwohl sie interessante Zusammenhänge aufweisen: Klienten, die ihre Therapeuten als selbstsicher einstufen, genesen eher. Burnout (beim Therapeuten) korreliert negativ mit dem Therapieerfolg, während der Zusammenhang zwischen dem emotionalen Wohlbefinden des Therapeuten und dem Outcome einheitlich positive Befunde aufweist. In allen neun Studien, die in diese Meta-Analyse einbezogen wurden, geht der Zusammenhang in die gleiche Richtung, mit Effektgrößen zwischen 0 und .72. Die gewichtete Effektgröße war mit r = .12, p < .05 signifikant, was die Ergebnisse von Meta-Analysen der Jahre 1968 – 1991 bestätigt (Beutler et a., 1994).
Der einheitliche Zusammenhang zwischen emotionalem Wohlbefinden des Therapeuten und Outcome legt ausgedehntere Forschungen zu diesem Zusammenhang nahe, sowie zur Art und Weise der Erhaltung des Wohlbefindens der Therapeuten, zur Burnout-Prophylaxe etc. “The mental health of psychotherapists [is] instrumental in their work” (Deutsch, 1985, S.305). Über den Einfluss sowohl von Kontrollüberzeugungen als auch von Werten und Einstellungen des Therapeuten, wie auch über den Einfluss von Religiosität kann hinsichtlich fehlender Forschungsarbeiten leider keine Aussage gemacht werden.
Im vierten Quadranten (therapeutische Beziehung, Erwartungen, Merkmale der sozialen Beeinflussung) befindet sich die Beteiligung des Therapeuten an der Beziehungsdyade, bzw. der Effekt der Beziehungsvariablen auf das Outcome, den die Meta-Analyse mit 0.22 beziffert. Sie geht direkt auf die Fähigkeit des Therapeuten zurück, eine warme, wertschätzende und angstfreie Beziehung aufzubauen und wird als zentrale Therapeutenvariable betrachtet (Beutler et al., 2004).
Fazit für die Praxis
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist der Therapeut, unabhängig von der Art der angewandten Intervention, zentral für den Erfolg einer Therapie. Nach den hier vorgestellten Ergebnissen sollte es für jeden Therapeuten wichtig sein, Burnout vorzubeugen bzw. für sein Wohlbefinden zu sorgen, seine sozialen Kompetenzen zu erweitern und zu pflegen und seinem Klientel gegenüber wohlwollend, aktiv, ausgeglichen und freundlich gegenüberzutreten. Wie das geschehen kann, darüber gibt es einige Untersuchungen, die ich in einem weiteren Artikel vorstellen möchte. Diese Erkenntnisse und besonders auch die zentrale Rolle des wohlwollenden Beziehungsaufbaus kann sicher auch fachübergreifend als interessant gewertet und fruchtbar angewandt werden, z.B. für Heilpraktiker, Ärzte, Krankenhauspersonal etc.
Literatur
- Beutler L. E., Machado, P. P. P. & Neufeldt, S. A. (1994). Therapist Variables. In A. E. Bergin & S. L. Garfield (Eds.) Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (4th ed.) (pp.229-269). New York: Wiley.
- Beutler, L. E., Malik, M., Alimohamed, S., Harwood, T. M., Talebi, H., Noble, S. & Wong, E. (2004). Therapist Variables. In Lambert, M. J. Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (5th ed.) (pp.227-306). New York: Wiley.
- Deutsch, C. J. (1985). A Survey of Therapists’ Personal Problems and Treatment. Professional Psychology: Research and Practice, 16, 305-315.
- Frank, J. D. (1981). Die Heiler. Wirkungsweisen psychotherapeutischer Beeinflussung. Vom Schamanismus bis zu den modernen Therapien. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grawe, K. (1995). Grundriss einer allgemeinen Psychotherapie. Psychotherapeut, 40, 130-145.
- Hubble, M. A., Duncan, B. L. & Miller, S. D. (Hrsg.). (2001). So wirkt Psychotherapie. Empirische Ergebnisse und praktische Folgerungen. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Lambert, M. J., Bergin, A. E. & Garfield, S. L. (2004). Introduction and Historical Overview. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (pp.3-15). New York: Wiley.
- Lambert, M. J. (1992). Psychotherapy Outcome Research: Implications for integrative and eclectic therapists. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds.), Handbook of Psychotherapy Integration (pp.94-129). New York: Wiley.
- Strauß, B. & Wittmann, W. W. (2005). Psychotherapieforschung. Grundlagen und Ergebnisse. In W. Senf & M. Broda (Hrsg.), Praxis der Psychotherapie. Ein integratives Lehrbuch (S.760-774). Stuttgart: Thieme.
- Perrez, M. & Baumann U. (1998). Psychotherapie. In U. Baumann & M. Perrez (Hrsg.), Klinische Psychologie – Psychotherapie (S.392-415). Bern: Hans Huber.
- Rogers, C. (1975). Empathic: An unappreciated way of Being. Person-Centered Review, 5 (2), 2-10.
Freie Übersetzungen der Autorin aller verwendeten englischen Zitate:
„Standardising the treatment has not eliminated the influence of the individual therapist on outcomes“ (Beutler et al., 2004, S.245).
“Die Behandlung zu standardisieren hat den Einfluss des jeweiligen Therapeuten auf das Ergebnis nicht beseitigt.“
Rogers, der Begründer, kommt „to the somewhat uncomfortable conclusion that the more psychologically mature and integrated the therapist is as a person, the more helpful is the relationship he provides. This puts a heavy demand on the therapist as a person” (1975, S.5).
“…zur etwas unangenehmen Schlussfolgerung, dass, je reifer und integrierter der Therapeut als Person ist, desto hilfreicher die Beziehung ist, die er zu Verfügung stellt. Dies stellt eine große Anforderung an die Person des Therapeuten.“
„Some therapists appear to be unusually effective, while others may not even help the majority of patients who seek their services. It is apparent that a portion of those whom therapy is intended to help are actually harmed through inept application of treatment, negative attitudes, or poor combination of treatment technique and patient problem” (Lambert et al., 2004, S.181).
“Einige Therapeuten scheinen ungewöhnlich effektiv, während andere nicht einmal der Mehrheit der Patienten helfen können, die ihre Dienste in Anspruch nehmen. Es ist offensichtlich, dass ein Teil derer, denen Therapie helfen soll, tatsächlich durch unpassende Anwendung der Interventionen, negative Einstellungen, oder eine schlechte Passung von Intervention und Patientenproblem geschädigt werden.“
“The mental health of psychotherapists [is] instrumental in their work” (Deutsch, 1985, S.305). Die psychische Verfassung der Psychotherapeuten ist an ihrer Arbeit maßgeblich beteiligt.
Autor: Keller Kathrin (Diplom-Psychologin & Heilpraktikerin für Psychotherapie)
NUTZUNG | HAFTUNG